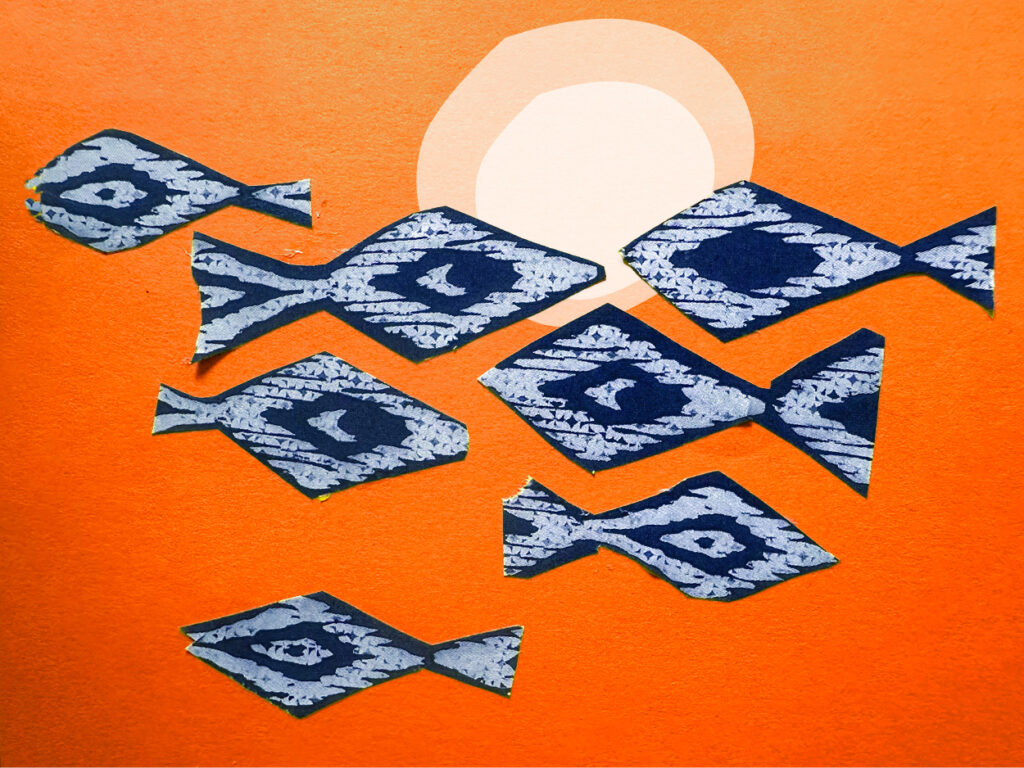Das deutsche Wort „Ostern“ leitet sich wahrscheinlich von dem altgermanischen Wort „Austro“ oder „Ausro“ ab, das übersetzt „Morgenröte“ heißt. Damit stellt sich eine Verbindung zu einer der Ostergeschichten aus den Evangelien her: Als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala, Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um damit zum Grab zu gehen und Jesus zu salben. Am ersten Tag der Woche kamen sie in aller Frühe zum Grab, als eben die Sonne aufging. (Mk 16,1-2) So verwundert es nicht, dass die „Morgenröte“ zu einem der stärksten Symbole der christlichen Osterfeste wurde und bis heute viele Ostergottesdienste am frühen Morgen gefeiert werden.
Mit diesem Text aus dem Markusevangelium sind wir aus historischer Sicht aber schon einige Jahrzehnte zeitlich nach dem, was sich unmittelbar nach dem Kreuzestod Jesu ereignete. Dieses Kapitel 16 wurde erst deutlich später an das eigentlich mit einem offenen Schluss beendete Evangelium angehängt. Jenes ist um das Jahr 70 herum abgeschlossen worden, also ungefähr 40 Jahre nach dem Tod Jesu.
Die frühesten Texte zur sogenannten Auferweckung Jesu (durch Gott-Jahweh) haben noch nicht die narrative Form der berühmten Ostergeschichten, sondern begegnen als sogenannte Glaubensformeln: Gott hat den Herrn auferweckt; er wird durch seine Macht auch uns auferwecken. (1 Kor 6,14) Oder: Wenn aber der Geist dessen in euch wohnt, der Jesus von den Toten auferweckt hat, dann wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, durch seinen Geist, der in euch wohnt. (Röm 8,11) Diese und andere schon in eine festere Form gebrachten Textstücke sind schon aus den Jahren 50 bis 55 nach Christus überliefert und wurden in den Jahren und Jahrzehnten davor offensichtlich in den ersten Gemeinden der Nachfolge Jesu gebildet und weitergegeben. Ausgesagt wird hier eine Kraft Gottes, die den getöteten Nazarener wieder „auferweckte“. Hier wird eine einmalige Machtqualität zum Ausdruck gebracht, die es auch schon in frühjüdischen Beschreibungen gab: Gott-Jahweh wird dort als Gott beschrieben, der die Toten lebendig macht (zum Beispiel im Achtzehnbittengebet) und der das Volk Israel machtvoll und treu aus der Knechtschaft Ägyptens in die Freiheit geführt hat. In den Sprachen des nördlichen Mittelmeerraumes hat sich daher in der Sprache das Fest der Befreiung „Pessach“ zum Beispiel im italienischen Wort für Ostern „Pasqua“ durchgesetzt. Gott ist nach diesen Bekenntnissen der Herr über Leben und Tod und somit ein Gott der Befreiung.
Eine weitere Formel, die sich in den Briefen des Paulus findet, setzt den Akzent ein wenig anders und spricht von „Erscheinungen“, die es nach dem Tod Jesu gab: Er ist begraben worden. / Er ist am dritten Tag auferweckt worden, / gemäß der Schrift, und erschien dem Kephas, dann den Zwölf. Danach erschien er mehr als fünfhundert Brüdern zugleich; die meisten von ihnen sind noch am Leben, einige sind entschlafen. Danach erschien er dem Jakobus, dann allen Aposteln. Zuletzt erschien er auch mir, gleichsam der Missgeburt. (1 Kor 15,4-8) Es muss zu außergewöhnlichen Begegnungserfahrungen mit einem lebendigen Jesus gekommen sein, bei Paulus erstaunlicherweise nur mit Männern und in einer klaren Reihenfolge. Bei dem hier benutzten Begriff óphthe „er ist erschienen“ könnten griechisch sprechende Menschen dabei sofort an ein Erscheinen Gottes gedacht haben. Wichtiger aber noch: Der Begriff macht klar, dass es hier nicht um Geister- oder Totenerscheinungen geht, sondern um eine Erscheinung in einem besonderen Leib, der sozusagen vom Himmel her kommt. Diese frühen Erscheinungshinweise kommen aber noch ohne jedes Tamtam daher und sind in ihren Beschreibungen eher zurückhaltend.
Aus Gerechtigkeitsgründen muss man an dieser Stelle auf einen Sachverhalt aufmerksam machen, der sich unbemerkt in die Erscheinungsberichte eingeschlichen hat. Offensichtlich wollten sich schon sehr früh Führungsgestalten der frühesten Gemeinde über ihre Erscheinungserfahrungen nicht nur als Auferstehungszeugen autorisieren, sondern auch ihre Führungsansprüche zum Ausdruck bringen. In der Aufzählung des Paulus wird als erster Petrus genannt, dann auch Jakobus und dann die anderen der 12 Gesandten, der Apostel. Die namentlich Genannten waren erwiesenermaßen im Kreis der bedeutendsten Führungspersönlichkeiten der Jerusalemer Urgemeinde angesiedelt. Aber wo bleiben hier die Frauen, die im ältesten Osterbericht ausdrücklich als erste Zeuginnen begegnen? Sie werden schon bei Paulus unterschlagen und scheinen nichts von der autoritativen Bedeutung der Begegnung mit dem Auferstandenen abzubekommen.
Das ist im ältesten Osterbericht im 16. Kapitel des Markusevangeliums noch anders. Hier spielen Frauen die entscheidende Rolle. Nachdem die beiden Marias und Salome in aller Frühe beim Grab Jesu angekommen sind, fragen sie sich: Wer könnte uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen? Doch als sie hinblickten, sahen sie, dass der Stein schon weggewälzt war; er war sehr groß. Sie gingen in das Grab hinein und sahen auf der rechten Seite einen jungen Mann sitzen, der mit einem weißen Gewand bekleidet war; da erschraken sie sehr. Er aber sagte zu ihnen: Erschreckt nicht! Ihr sucht Jesus von Nazaret, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden; er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wohin man ihn gelegt hat. Nun aber geht und sagt seinen Jüngern und dem Petrus: Er geht euch voraus nach Galiläa; dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat. Da verließen sie das Grab und flohen; denn Schrecken und Entsetzen hatte sie gepackt. Und sie sagten niemandem etwas davon; denn sie fürchteten sich. (Mk 16,3-8)
Interessant! Die Erscheinung wird nur durch einen jungen Mann in weißem Gewand angekündigt. Die Frauen setzen aber den Info-Auftrag an die männlichen Jünger nicht um, sondern behalten ihre Erlebnisse einfach für sich. Auch im Johannesevangelium spricht Jesus mit Maria von Magdala, die ihn nicht erkennt: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meinte, es sei der Gärtner, und sagte zu ihm: Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir, wohin du ihn gelegt hast! Dann will ich ihn holen. (Joh 20,15) und bei Lukas heißt es: Und siehe, am gleichen Tag waren zwei von den Jüngern auf dem Weg in ein Dorf namens Emmaus, das sechzig Stadien von Jerusalem entfernt ist. Sie sprachen miteinander über all das, was sich ereignet hatte. Und es geschah, während sie redeten und ihre Gedanken austauschten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Doch ihre Augen waren gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. (Lk 24,13-16) Auch hier „blicken“ zwei seiner Jünger nicht, dass der auferweckte Jesus von Nazaret direkt neben ihnen geht. Erst ganz am Schluss eines immerhin einige Kilometer langen Weges und nachdem sie den Fremden in ihr Dorf Emmaus eingeladen haben, kommt es zu der entscheidenden Erkenntnis: Und es geschah, als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen aufgetan und sie erkannten ihn; und er entschwand ihren Blicken. (Lk 24,30-31) In der Reinszenierung des gemeinsamen Jesusmahls mit seinen besonderen Abläufen kommt ihnen die entscheidende Erkenntnis und schwupp – ist er schon wieder entschwunden! Nach diesen Berichten geht es somit keineswegs um Beweisverfahren rund um ein leeres Grab und eine handfeste Erscheinung, sondern darum, die Bedeutung dessen, was da in diesem Erscheinungsgeschehen geschieht, erst zu erkennen und das Erfahrene entsprechend zu interpretieren. Selbst ein nach einer Auferstehung leeres Grab, von dem erstaunlicherweise in den Briefen des Paulus nichts zu lesen ist, ist für den Glauben an die Auferweckung des Nazareners nicht von entscheidender Bedeutung. Es löst von sich aus keinen Glauben aus.
Entscheidend hinter dem Themenkomplex leeres Grab, Botschaft von der Auferweckung und Erscheinungen ist aber dies: Die Berichte heben immer hervor, dass der auferweckte Jesus und der Jesus, den sie aus seinem irdischen leben kennen, ein und derselbe ist. Auch wenn die Berichte nicht verschweigen, dass sie Jesus nicht immer sofort erkennen. Der Jesus, der getötet und begraben wurde, ist nach diesen Zeugnissen genau derjenige, den Gott aus diesem Todeszustand heraus auferweckt hat.
Der auferstandene Jesus reaktiviert sozusagen immer wieder die Verbindungslinien zu seinen Anhänger:innen, indem er den Friedensgruß spricht, die jüdischen Schriften auslegt und erklärt und mit ihnen das Mahl feiert wie zuvor. Er zeigt ihnen sogar seine Wunden, fordert auf, diese zu berühren und isst sogar einen gebratenen Fisch. Es soll sozusagen haptisch fühlbar werden, dass der gekreuzigte Jesus nun real und leiblich vor ihnen steht.
Aber dieses Wiedererkennen soll in erster Linie die Anhänger:innen Jesu von Zweifelnden, Nichtglaubenden und Unwissenden in Erkennende und Glaubende verwandeln und erfüllen und damit auch die Botschaft und das Wirken des vorösterlichen Jesus wieder in ein neues Licht stellen: Der von den Toten Erstandene vermittelt keine neue Lehre, sondern bekräftigt durch seine Erscheinung die alte, die er ihnen vermittelt hatte.
In der späteren Überlieferung des Matthäusevangeliums wird das Auferweckungsgeschehen dann spektakulärer und es finden sich übernatürliche und apokalyptische Motive: Der Vorhang riss im Tempel von oben bis unten entzwei. Die Erde bebte und die Felsen spalteten sich. Die Gräber öffneten sich und die Leiber vieler Heiligen, die entschlafen waren, wurden auferweckt. Nach der Auferstehung Jesu verließen sie ihre Gräber, kamen in die Heilige Stadt und erschienen vielen. (Mt 27,51-53) Hier wird erkennbar. Das Anbrechen der neuen Zeit, die mit dem Herrschaftsantritt Gottes verbunden ist und die Jesus in Worten, Taten und Zeichen verkündet und verkörpert hat, beinhaltet nach apokalyptischem Denken nicht nur die Auferweckung eines, sondern aller Toten. Auf diese Art und Weise fand der Glaube an die allgemeine Totenauferstehung Einzug in das frühchristliche Denken, war aber durchaus auch vorher schon Bestandteil jüdischer Gruppen wie zum Beispiel der Pharisäer. In einem Streitgespräch mit den Sadduzäern hielt bereits der irdische Jesus fest: Wenn nämlich die Menschen von den Toten auferstehen, heiraten sie nicht, noch lassen sie sich heiraten, sondern sind wie Engel im Himmel. Dass aber die Toten auferstehen, habt ihr das nicht im Buch des Mose gelesen, in der Geschichte vom Dornbusch, in der Gott zu Mose spricht: Ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs? Er ist kein Gott von Toten, sondern von Lebenden. (Mk 12,25-27)
Zusammenfassend lässt sich somit sagen: Es sind eher die stillen Begegnungen und Erfahrungen in der Begegnung der Anhänger:innen Jesu in den sogenannten Erscheinungsberichten als spektakuläre Darstellungen wie im Matthäusevangelium, die zum historischen Kern des Ostergeschehens gehören. Diese „Erscheinungen“ werden als glaubhafte Berichte von Zeuginnen und Zeugen beschrieben. Der „Glaube“ an den weiter unter ihnen lebendigen Jesus ist dabei kein Automatismus, sondern entwickelt sich auch unter seinen treuesten Anhänger:innen nicht selten durch ihre Zweifel hindurch und erschließt sich für die einzelnen Menschen eher als eine Erkenntnis, die sich erst langsam, aber dann doch befreiend und hoffnungsstiftend durchzusetzen beginnt.
[Literatur u.a.: Christine Jacobi, in Jesu Handbuch S.488ff.]