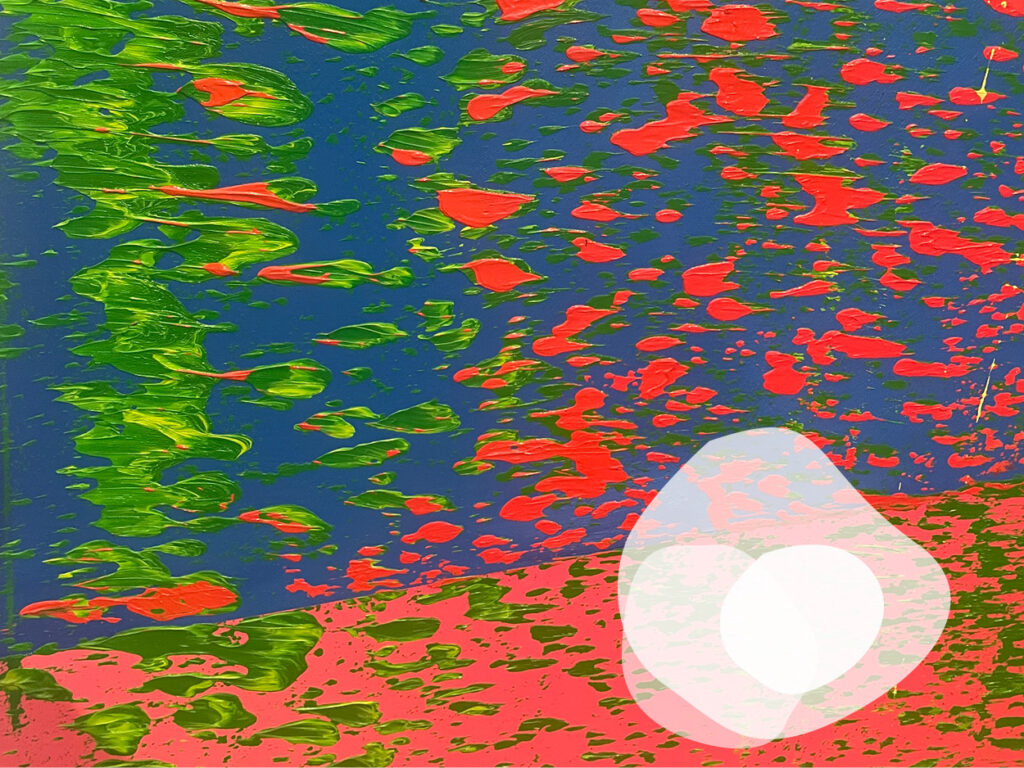Wer sich mit dem beschäftigen möchte, was für Jesus von Nazaret so etwas wie den Kern oder die Mitte seiner ethischen Überzeugung und Lehre bildete, stößt in der Jesusüberlieferung auf drei zentrale Vorstellungen: Die Nächstenliebe, die Fremdenliebe und die Feindesliebe. Für die meisten Menschen ist dabei die Nächstenliebe kein Problem, sie scheint attraktiv und nachvollziehbar, bei der Fremdenliebe wird das dann schon etwas schwieriger und die Feindesliebe wird von vielen wohl als nicht umsetzbar oder eine Zumutung empfunden.
Zunächst ist Vorfeld zu klären, was denn unter den Begriffen „Liebe“ und „lieben“ zur Zeit Jesu eigentlich verstanden wurde. Heute verbindet man den Begriff der „Liebe“ sehr stark mit positiven Emotionen, Gefühlen und direktem Interesse gegenüber dem, was wir lieben. Das können ein Partner sein oder Verwandte oder Freund:innen, aber auch Tiere, ein Hobby, eine Kunst, usw.
In der Antike meinen die im Neuen Testament benutzten Begriffe agapan-lieben oder agape-Liebe mehr als die emotionale Seite. Die Agape-Liebe meint zuallererst das Eingehen oder Aufrechterhalten sozialer Bindungen. Der Gegenbegriff dazu ist misein-hassen. Das meint demgegenüber eben die Auflösung bzw. den Abbruch sozialer Bindungen.
Wenn also in den ersten Büchern des Alten Testaments aufgefordert wird, im Land wohnende Nächste und Fremde zu lieben, geht es nicht in erster Linie um das Hegen positiver Gefühle. Auch hier geht es um die Bereitschaft, diese in das soziale Netz einzuschließen bzw. nicht auszuschließen. Im Blick auf die eigenen Landsleute heißt es: An den Kindern deines Volkes sollst du dich nicht rächen und ihnen nichts nachtragen. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. / oder: er ist wie du. (Lev 19,18) Es geht hier somit zunächst um einen Verzicht auf Rache gegenüber den eigenen Landsleuten – den Nächsten. Es wird die Aufforderung deutlich, auch denen Gutes zu tun, die mir bewusst geschadet oder mir Unrecht getan haben. Allein das ist ja schon eine Herausforderung.
Ein paar Sätze später geht es dann um die Fremden, die ja auch im eigenen Land leben: Wenn bei dir ein Fremder in eurem Land lebt, sollt ihr ihn nicht unterdrücken. Der Fremde, der sich bei euch aufhält, soll euch wie ein Einheimischer gelten und du sollst ihn lieben wie dich selbst; denn ihr seid selbst Fremde in Ägypten gewesen. (Lev 19,33f) Wichtig ist dabei zu bedenken: Der Fremde ist hier aus ökonomischen wie sozialen Gründen nicht in der Lage, mir Gutes zu tun, das zurückzugeben, was ich ihm gegeben habe. Sie sollen trotzdem in die soziale Gemeinschaft, in das soziale Netz eingebunden werden.
Nach Ansicht des Bibelwissenschaftlers Wolfgang Stegemann ist für die Antike folgendes Denkmuster typisch: Es gibt eine Form von Solidarität auf Gegenseitigkeit. Es geht nicht darum, einen Gewinn zu erzielen, sondern um eine „Symmetrie des Austauschs“. Die Waage des menschlichen Zusammenlebens muss gut austariert sein im Sinne einer Reziprozität: Im gegenseitigen Geben und Nehmen auf der Basis von Gegenseitigkeit und Wechselseitigkeit entsteht Vertrauen und ein gutes Miteinander. Aber was passiert, wenn Jemand aus diesem System aussteigt, weil er mich hasst und bekämpft, oder wenn ein Mensch aus wirtschaftlichen Gründen nicht in der Lage ist, das Gegebene wieder auszugleichen?
Für diesen Punkt lehrt Jesus in der Linie der Tora-Weisungen, aus diesem üblichen Muster auszusteigen und gegenüber denen in Vorleistung zu gehen, die mir feindlich gesinnt sind oder mir nichts zurückgeben können. (AS 156) Das bedeutet dann: Es gibt keinen Ausgleich für einen erlittenen Schaden oder Verlust. Dieses Muster wird hier durchbrochen um des höheren Werts einer in Achtung und Liebe gelebten Existenz willen. Der Bibelwissenschaftler Wolfgang Stegemann stellt dazu auch fest: Die beiden zentralen Gebote der Fremden- und der Feindesliebe kommen auch an anderen Stellen in der biblischen Tora-Weisung vor (Dtn 10,18f; Ex 22,20; 23,9) und sie stimmen mit dem Anliegen Jesu überein. Jesus hat sie seiner Meinung nach also nicht „erfunden“, sondern aus der jüdischen Tradition übernommen. Damit positioniert er sich gegen die Ansicht von z.B. Gerd Theißen und Annette März. Diese gehen davon aus, dass es Jesus war, der das Liebesgebot ausgeweitet und verschärft hat. Auch Angelika Strotmann wehrt sich gegen die übliche Behauptung, es sei Jesus gewesen, der das Gebot der Nächstenliebe durch das Gebot von Nächsten- und Feindesliebe „ausgeweitet, radikalisiert und universalisiert“ hätte. (AS 156)
Alles, was Jesus tut und lehrt, entspringt somit aus den Quellen der jüdischen Weisung, der Tora. Das Zentrum seiner ethischen Linie bildet zum einen das Gebot der Alleinverehrung Gottes bzw. der Gottesliebe: Höre, Israel! Der HERR, unser Gott, der HERR ist einzig. Darum sollst du den HERRN, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft. (Dtn 6,4f) Dazu kommt das Gebot der Nächstenliebe, das nach der Auffassung des Judentums seiner Zeit den Willen Gottes in ganz besonderer Weise zum Ausdruck bringt. Auf die Frage eines Schriftgelehrten hin antwortet er daher: Welches Gebot ist das erste von allen? Jesus antwortete: Das erste ist: Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Als zweites kommt hinzu: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist größer als diese beiden. (Mk 12,28b-31) In der konkreten Umsetzung dieses Doppelgebots verwirklicht sich ein vor Gott und für die Menschen gelingendes Leben.
Die Liebe zum Nächsten, der auch ein Fremder oder ein Feind sein kann, wird unter anderem im Gleichnis vom barmherzigen Samariter beschrieben und entfaltet, hier ausgerechnet aus der Sicht eines jüdischen Mannes, der als eine Abspaltung aus der jüdischen Mitte durchaus als Fremder und vielleicht auch manchmal als Feind gesehen wurde.
Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab und wurde von Räubern überfallen. Sie plünderten ihn aus und schlugen ihn nieder; dann gingen sie weg und ließen ihn halbtot liegen. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab; er sah ihn und ging vorüber. Ebenso kam auch ein Levit zu der Stelle; er sah ihn und ging vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam zu ihm; er sah ihn und hatte Mitleid, ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann hob er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn zu einer Herberge und sorgte für ihn. Und am nächsten Tag holte er zwei Denare hervor, gab sie dem Wirt und sagte: Sorge für ihn, und wenn du mehr für ihn brauchst, werde ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen dreien meinst du, ist dem der Nächste geworden, der von den Räubern überfallen wurde? Der Gesetzeslehrer antwortete: Der barmherzig an ihm gehandelt hat. Da sagte Jesus zu ihm: Dann geh und handle du genauso! (Lk 10,30-37)
Fürsorge, Barmherzigkeit, Empathie und aktives Handeln und Helfen: Das sind wichtige Fundamente, um der Liebesweisung des jüdisch-christlichen Glaubens entsprechen zu können. Das Beispiel des Samariters soll stilprägend sein.
Daneben sind aber auch die Weisungen Jesu zur Fremden- und Feindesliebe konkrete Umsetzungen jüdischer Tora-Weisung, wie sie auch im Buch Levithikus (19,18 & 19,33) begegnet: Dem, der dich bittet, gib, und von dem, der sich von dir leiht, fordere das deine nicht zurück. (Lk 6,30) Oder: Wer dich auf die Wange schlägt, halt ihm auch die andere hin; und wer dein Untergewand nehmen will, lass ihm auch das Obergewand. (Lk 6,29) Und dann auch: Und wer dich zu einer Meile [Frondienst] zwingt, gehe mit ihm zwei.(Mt 5,41)
Hier zeigt sich eine subversive Kreativität, eine Form von irritierender Überraschung. Jesus fordert zu einer „paradoxen Intervention“ auf, die den Gegner überrascht und die Dynamik der Gewaltspirale durchbricht. Der oder die Geschlagene bewahrt darin gleichzeitig die Handlungshoheit und wird nicht einfach zum Opfer oder Objekt der oder des anderen.
Deutlich wird diese Dimension der Feindesliebe auch im konkreten Verhalten Jesu: In seiner
demonstrative Zuwendung zu Menschen, die als „Sünder“ angesehen wurden und mit denen man Kontakte möglichst vermied. In der Achtung ihm entgegengebrachter Liebeserweise und von Gastfreundschaft (Zachäus, Salbung, …). Es geht auch hier letztlich um die Nachahmung Gottes, die „imitatio dei“: Seid also vollkommen, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist! (Mt 5,48)
Zusammenfassend lässt sich sagen: Jesus steht im Blick auf die Leitlinien seiner Ethik ganz auf dem Boden der jüdischen Weisung, der Tora. Sie sollen zu einem gelingenden Leben aller beitragen und gelten auch gegenüber Fremden und Feinden, die nicht sozial ausgegrenzt werden sollen. Dazu sollen auch die Mittel der eigenen Kreativität und Klugheit eingesetzt werden. Alles im Bewusstsein der universalen Liebe Gottes.
[AS 155ff / T-M 344f]