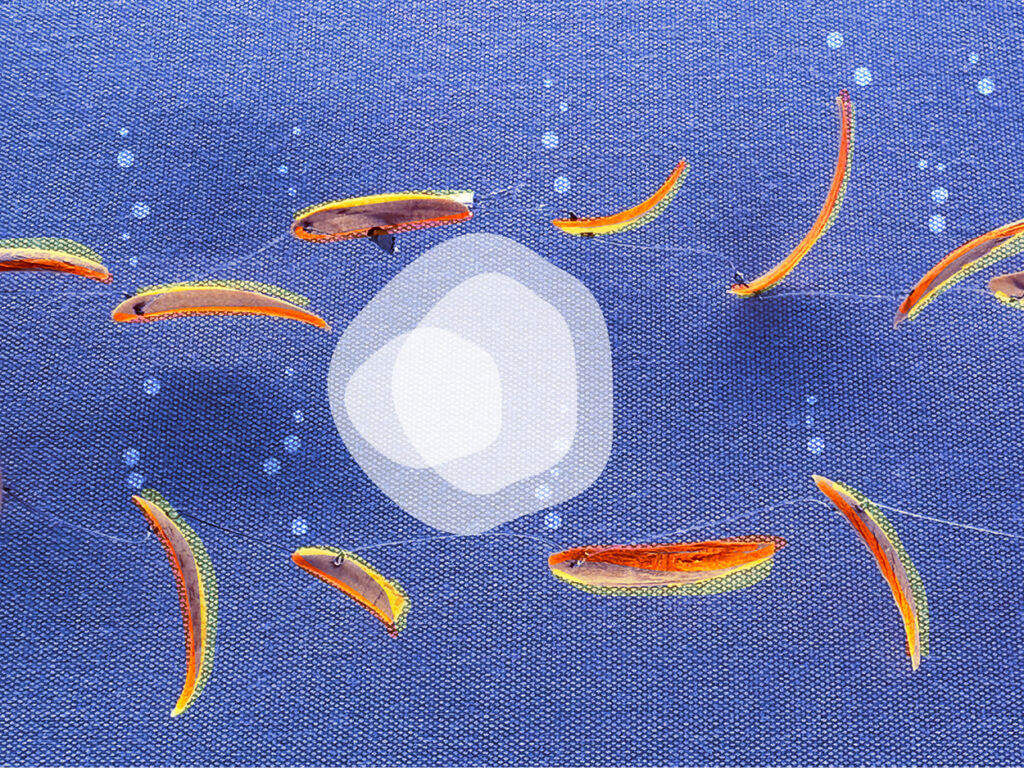Viele Jahrzehnte lang wurde Jesus in der europäischen Kunst und in der Verkündigung als Zimmermann dargestellt, Schwerpunkt Holzbearbeitung. Dies ist eine erhebliche Verkürzung. Die Tätigkeiten des Bauhandwerkers umfassten weit mehr. Er war auch in der Lage, Steine zu bearbeiten, Türen und Häuser zu bauen, und einiges mehr. Möglicherweise kannte er sich auch im Schleusenbau aus und konnte einen Sattel ausbessern. Der Schwerpunkt in Galiläa wird aber sicher der Umgang mit Steinen gewesen sein.
Diesen Beruf des Bauhandwerkers hatte er von seinem Vater Josef erlernt. Im späteren rabbinischen Judentum hatte der Vater in jedem Fall die Pflicht, seinen Sohn ein Handwerk zu lehren. Mit seinem Vater wird er auf den Baustellen der Region unterwegs gewesen sein, mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in der nur wenige Kilometer entfernten Stadt Sepphoris. Diese wurde nach der teilweisen Zerstörung durch die Römer im Jahr 4 v.Chr. durch den Tetrarchen Herodes Antipas wieder zur Hauptstadt Galiläas aufgebaut.
Ein solches Handwerkerleben „auf Montage“ hat seinen Blick über das Dorfleben in Nazaret hinaus geweitet. Er begegnet griechisch-hellenistischer Kultur im ansonsten jüdisch geprägten Sepphoris mit seinem Amphitheater und der für diese Kultur offenen Bevölkerung. Er lernt das Leben und die Arbeit der Fischer vom See Genesaret und vieles andere mehr kennen. Das wirkt sich auf die Bilder aus, die er in seiner Sprache und insbesondere in seinen Gleichnissen verwendet. Er spricht vom Marktplatz, der Agora, auf dem die Kinder spielen, vom Stadttor, er spricht vom langen Weg zum Gericht, den man etwa von Nazaret in die nächste Stadt zu gehen hatte. Relativ spärlich dagegen sind die Bildworte, die mit seiner handwerklichen Tätigkeit zu tun haben. Zu nennen sind das Bild vom Hausbau (u.a. Mt 7,24-27), vom Balken und dem Splitter (u.a. Mt 7,3-5) und vom Turmbau (Lk 14,28-30):
Denn wenn einer von euch einen Turm bauen will, setzt er sich dann nicht zuerst hin und berechnet die Kosten, ob seine Mittel für das ganze Vorhaben ausreichen? Sonst könnte es geschehen, dass er das Fundament gelegt hat, dann aber den Bau nicht fertigstellen kann. Und alle, die es sehen, würden ihn verspotten und sagen: Der da hat einen Bau begonnen und konnte ihn nicht zu Ende führen. (Lk 14,28-30)
Der mittlerweile verstorbene Bibelexperte Klaus Berger entdeckt in dem Bauhandwerker einen Mann, „der an Weltklugheit und an Sachkunde in Alltagsdingen kaum zu übertreffen ist, der Vorgänge und Menschen genau beobachtet, der weiß, wo die Schwächen, ja die Abgründe der Skrupellosigkeit des Herzens liegen“. Ob diese Einschätzung möglicherweise etwas zu gewagt ist, lässt sich schwer sagen. Sie macht in jedem Fall aber deutlich: Jesus war keineswegs nur ein auf sein Dorf, seinen Beruf und seine Familie beschränkter Provinzler!
Der Blick auf seinen Umgang mit der Natur zeigt darüber hinaus: Jesus war auch ein aufmerksamer Beobachter seiner Mitwelt und insbesondere der Natur, die ihn immer wieder zu Vergleichen und Bildworten anregte. Sehr anschaulich wird dies in der Mitte der Bergpredigt, als er auf die Vögel und die Feldblumen verweist:
Seht euch die Vögel des Himmels an: Sie säen nicht, sie ernten nicht und sammeln keine Vorräte in Scheunen; euer himmlischer Vater ernährt sie. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? (…) Und was sorgt ihr euch um eure Kleidung? Lernt von den Lilien des Feldes, wie sie wachsen: Sie arbeiten nicht und spinnen nicht. Doch ich sage euch: Selbst Salomo war in all seiner Pracht nicht gekleidet wie eine von ihnen. (Mt 6,27.28.29)
Der frühere Bibelwissenschaftler Joachim Gnilka schließt aus solchen Worten: „Aus den von selbstquälerischer Sorge gelösten Worten spricht ein freier und gelöster Mensch. Die Worte sind auch deshalb so kostbar, weil sie uns ein vielfach vergessenes Jesusbild aufbewahren. Es zeigt uns einen heiteren, in der Geborgenheit Gottes sich sicher fühlenden Menschen.“
Neben der Situation der Familie Jesu möchte man heute gern wissen, ob Jesus auch Freund:innen hatte. An einer Stelle im Johannesevangelium ist ausdrücklich von einem Freund die Rede, einem Mann namens Lazarus, der in Bethanien lebt. Jesus findet ihn bereits tot und in einer Gruft begraben. Als dessen Schwester Maria und weitere Begleiter beginnen, am Grab stehend zu weinen, fließen auch bei ihm die Tränen der Trauer um den Freund.
Wie sich der Gedanke der Freundschaft in der Welt des historischen Jesus entfaltet hat, wissen wir leider nicht. Sicher wird es im Umfeld Jesu Freundschaften gegeben haben, sowohl zu den Anhänger:innen als dort auch untereinander. Ausdrücklich nennt Jesus sie im Johannesevangelium „Freunde“: Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Ich nenne euch nicht mehr Knechte; denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr habe ich euch Freunde genannt (…). (Joh 15,14f) Möglicherweise war der „Jünger, den Jesus liebte“, wie er im Johannesevangelium gekennzeichnet wird, ein besonderer Freund des Nazareners. Dort heißt es im Text zum letzten Abendmahl, nachdem Jesus sagt, einer ihnen werde ihn ausliefern, also verraten: Die Jünger blickten sich ratlos an, weil sie nicht wussten, wen er meinte. Einer von den Jüngern lag an der Seite Jesu; es war der, den Jesus liebte. 24 Simon Petrus nickte ihm zu, er solle fragen, von wem Jesus spreche. Da lehnte sich dieser zurück an die Brust Jesu und fragte ihn: Herr, wer ist es? Jesus antwortete: Der ist es, dem ich den Bissen Brot, den ich eintauche, geben werde. (Joh 13,26-29) Hier wurde auch in den Bibelwissenschaften viel interpretiert und gerätselt. Ein zu enges und abgehobenes Bild von Jesus sollte man sich sicher nicht machen. Doch wie es im Blick auf mögliche Freundschaften verhielt – da kommt man über Vermutungen nicht hinaus.