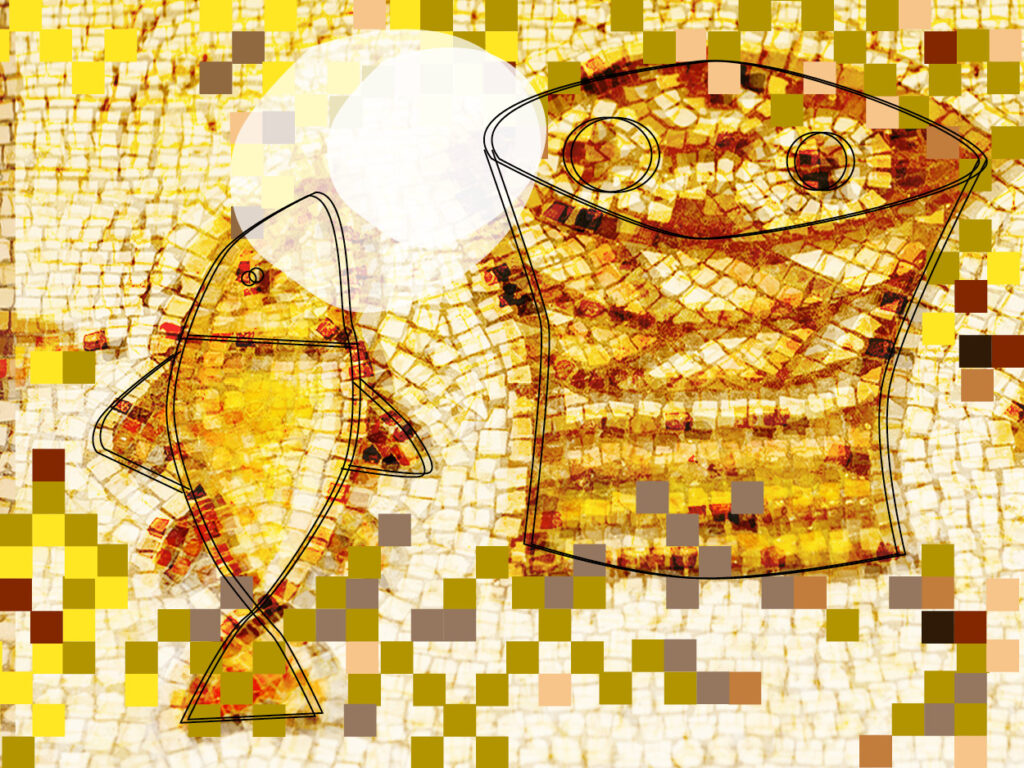In der Geschichtswissenschaft unterscheidet man das historische Material in „Überreste“ und in „Quellen“. Bei Quellen handelt es sich um Zeugnisse, die explizit von Menschen geschaffen worden sind, um sie für die Nachwelt zu erhalten. Überreste hingegen sind Zeugnisse aus der Vergangenheit, die nur einen temporären Nutzen hatten und für den Gebrauch in der damaligen Zeit bestimmt waren. Für die historische Jesusforschung sind Überreste also alle Informationen, die uns etwas über den politischen, religiösen, sozialen und kulturellen Kontext Jesu liefern. Hierfür spielt vor allem die Archäologie und die archäologischen Zeugnisse aus Galiläa eine wichtige Rolle. Zu den wichtigsten Überresten aus der Zeit Jesu gehören:
- Die Pilatusinschrift von Cäsarea Maritima: Die Inschrift belegt, dass Pontius Pilatus die Amtsbezeichnung „Präfekt“ (lat. praefectus) innehatte und nicht „Prokurator“, wie Tacitus schreibt.
- Dann das Kaiaphas-Ossuar: Ein Knochenkasten mit der Aufschrift: „Joseph, Sohn des Kaiaphas“; ein mögliches Familiengrab des Hohepriesters Kaiaphas, den auch die Evangelien nennen und drittens …
- Das sog. „Jesus-Boot“: ein Boot aus dem 1. Jahrhundert n. Chr., das 1986 aus dem See Genezareth geborgen wurde; das Boot kann beispielsweise eine Szene aus dem Markusevangelium veranschaulichen, in der es heißt, dass Jesus im Heck eines Bootes schlief (Mk 4,35-41)).
Die Quellen, die hingegen von Jesus berichten, lassen sich in zwei große Kategorien einteilen: Außerchristliche Quellen und christliche Quellen. Wie der Name bereits verrät, stammen die außerchristlichen Quellen von Autoren, die in keinem direkten Zusammenhang mit dem frühen Christentum standen und sich nicht als Christen betrachteten. Die Texte dieser Autoren liefern eine außerbiblische Perspektive über das frühe Christentum und Jesus. Die folgenden Autoren und ihre dazugehörigen Werke erwähnen Jesus von Nazareth:
- Der jüdische Geschichtsschreiber Flavius Josephus in den Antiquitates Iudaicae (18,63f und 20,200 – ca. 93 n. Chr.)
- Der römische Geschichtsschreiber Tacitus in den Annalen (15,44,3 – ca. 116/117 n. Chr.)
- Der römische Geschichtsschreiber Sueton in De Vita Caesarum (Claud 25,4 – ca. 120 n. Chr.)
- Der römische Staatsbeamte und Schriftsteller Plinius der Jüngere (Plinius-Briefe, 10, 96 – ca. 111 n. Chr.)
- Der griechisch-römische Satiriker Lukian von Samosata in De morte Peregrini (11-13,16 – ca. 170 n. Chr.)
All diese Quellen gehen von der Existenz des historischen Jesus aus. So lässt sich bei Tacitus nachlesen, dass Jesus – Tacitus nennt ihn in seinen Annalen „Christus“ – unter Pontius Pilatus hingerichtet worden sei. Außerdem sieht Tacitus „Christus“ als Gründer / Urheber der religiösen Gemeinschaft der Christen, die er aber als Chrestianer (lat. „Chrestianos“) bezeichnet.
Der römische Historiker sah keinen Anlass zu Zweifeln, dass der historische Jesus tatsächlich existierte. Nichtsdestotrotz sind die wenigen Aussagen über den historischen Jesus in den außerchristlichen Quellen nicht ausreichend, um von einer gesicherten Quellenlage zu sprechen.
Für die Rekonstruktion des Lebens und Wirkens Jesu benötigt die historische Jesusforschung die frühen christlichen Quellen, die auch deutlich mehr Informationen über Jesus beinhalten, als die außerchristlichen Quellen. Die wichtigsten christlichen Quellen sind die kanonisierten (in der Bibel auffindbaren) Evangelien. Dabei sind die Evangelien nach den erst später mit Namen versehenen Verfassern der Texte benannt. Diese sind:
- Das Markusevangelium von ca. 70 n. Chr. (inklusive eines alten Passionsberichts)
- Das Lukasevangelium und Matthäusevangelium von ca. 80-90 n. Chr. (Sie benutzen bereits das Markusevangelium und die sogenannte Spruchquelle Q*)
- Das Johannesevangelium von ca. 100 n. Chr.
Durch die Evangelien ist eine (grobe) Rekonstruktion des Lebens und Wirkens Jesu möglich.
So erfahren wir aus dem Lukas- und Matthäusevangelium, dass der historische Jesus auf die Welt kam, als Herodes der Große herrschte (Mt 2,1 und Lk 1,5). Somit lässt sich die Geburt Jesu auf die Jahre 6-4 v. Chr. datieren. Vor allem in der Region um den See Genezareth soll Jesus bis ca. 28-30 n. Chr. gewirkt haben. Außerdem erfahren wir, dass Jesus am 14. / 15. Nisan in Jerusalem gekreuzigt wurde. Als wahrscheinlichstes Todesjahr nimmt die Bibelwissenschaftlerin Angelika Strotmann das Jahr 30 n.Chr. an. Neben den Evangelien aus der Bibel gibt es weitere Evangelien oder gleichartige Schriften und Fragmente, die nicht in den Kanon der Bibel aufgenommen wurden. In der bibelwissenschaftlichen Forschung spielt vor allem das sogenannte Thomasevangelium (ca. 120 n Chr.) eine wichtige Rolle.
Allgemein ist in Bezug auf die Gattung der Evangelien zu sagen, dass nicht die Entwicklungsgeschichte und das psychologische Bild Jesu im Vordergrund standen, sondern sein öffentliche Rolle und sein nach außen erkennbares Wirken. Die Frage nach der Erziehung, der Bildung und dem Charakter Jesu waren nur im Blick auf das öffentliche Wirken von Interesse (AS 56). Die Evangelien enthalten bereits eine christologische Interpretation des Handelns Jesu, weshalb eine Rekonstruktion des historischen Jesus anhand der Evangelien ebenfalls nur unter Vorbehalt möglich ist.
Der Anspruch der wissenschaftlichen historisch-kritischen Bibelwissenschaft ist deshalb, Jesus von Nazareth nicht von seiner Göttlichkeit, sondern von seiner Menschlichkeit her zu begreifen. Dies geschieht insbesondere mit den Werkzeugen der Geschichtswissenschaft und der Literaturwissenschaft (AS 35f). Ob etwas historisch plausibel ist, also der historisch-kritischen Analyse standhält, wird anhand von Kriterien entschieden, die aus der Geschichtswissenschaft übernommen wurden. Hier wäre zum Beispiel das Kriterium der Unabhängigkeit der Quellen zu nennen.
Durch die vielfältigen christlichen und außerchristlichen Berichte über Jesus von Nazareth lässt sich aus Sicht der historisch-kritischen Bibelwissenschaft und der historisch-kritischen Jesusforschung sagen, dass es eine gesicherte Quellenlage über den historischen Jesus gibt.
[Literatur u.a.: Jens Schröter, Jesus von Nazaret
62017, S.45-77 | Schröter, Jacobi, Jesus-Handbuch, S. 126-181 | Angelika Strotmann, Der historische Jesus ³2019, S.35ff.)
*Bei der Spruchquelle Q (auch Logienquelle genannt) handelt es sich um eine hypothetische Zusammenstellung von Aussprüchen Jesu. Ob die Spruchquelle Q existiert hat, wird in der Forschung seit dem Ende des 19. Jahrhunderts stark diskutiert. Da keine Handschriften der Spruchquelle Q überliefert sind, bleiben Vermutungen über den Umfang, den Inhalt, das literarische Profil und die Existenz rein hypothetisch (JS 58f).