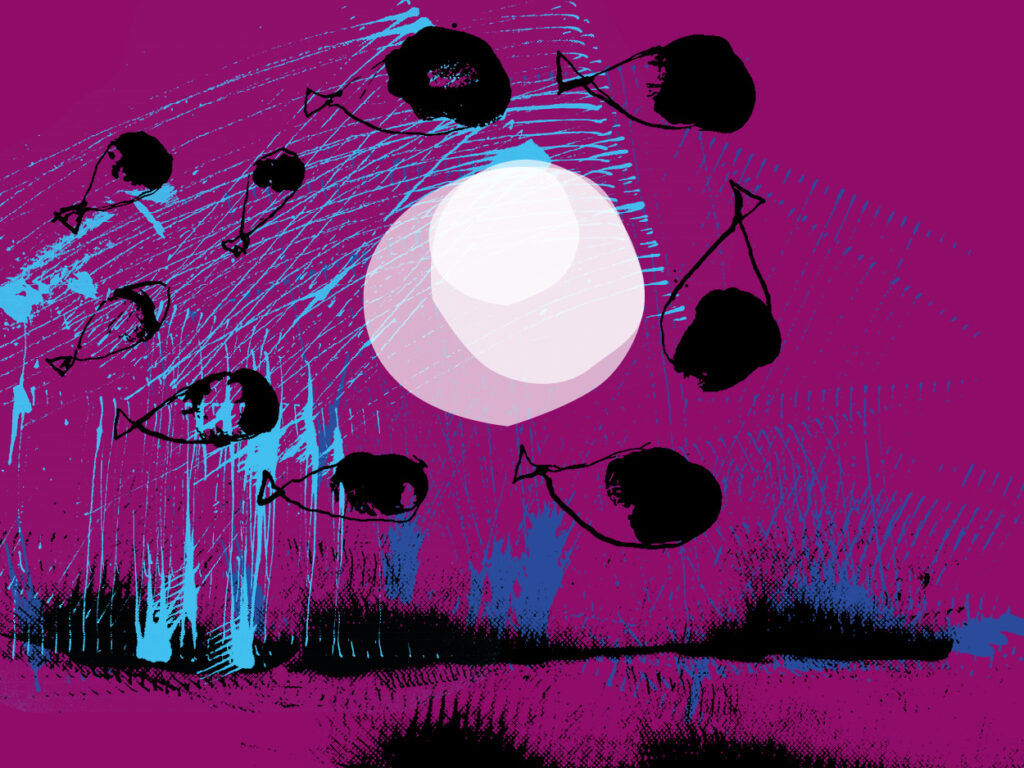Die historische Tatsache der Kreuzigung Jesu auf Veranlassung des römischen Präfekten Pontius Pilatus steht außer Frage. Zwei außerchristliche Quellen sind in dieser Hinsicht besonders aussagekräftig:
Der römische Historiker Tacitus berichtete um das Jahr 115 über die „Christiani“: Dieser Name stammt von Christus, der unter Tiberius vom Prokurator Pontius Pilatus hingerichtet worden war. (Ann 15,44,3) Mit Tiberius ist der von 14 bis 37 nach Christus regierende Kaiser gemeint. Allerdings ist Tacitus ein Fehler unterlaufen. Pontius Pilatus war kein „Prokurator“, also ein Legionskommandant in der Provinz Syrien sondern ein „Präfekt“, ein Statthalter des Kaisers in Judäa. Tacitus gibt darüber hinaus zu erkennen, dass er die Hinrichtung Jesu für rechtmäßig hielt.
Anders der jüdische Geschichtsschreiber Flavius Josephus, der von cirka 37 bis 100 nach Christus lebte. Dieser erwähnt die Hinrichtungsart der Kreuzigung und nennt als Initiatoren die „Vornehmsten unseres Volkes“. Josephus stellt Jesus außerordentlich positiv dar und stellt die Rechtmäßigkeit seines Todes in Frage. (Ant 18,63f./ 18,3.3)
Aus den Paulusbriefen als den frühesten christlichen Quellen, die zwischen 50 und 60 nach Christus verfasst wurden, kann man nur entnehmen, dass Jesus gekreuzigt wurde: zum Beispiel in den Briefen an die Galater (Gal 5,24) und an die Korinther. (1 Kor 1,13.23) Im Brief an die Thessaloniker wird noch erwähnt, dass Judäer daran beteiligt waren: Denn, Brüder und Schwestern, ihr seid dem Beispiel der Gemeinden Gottes in Judäa gefolgt, die in Christus Jesus sind. Ihr habt von euren Mitbürgern das Gleiche erlitten wie jene von den Juden. Diese haben Jesus, den Herrn, und die Propheten getötet; auch uns haben sie verfolgt. (1Thess 2,14-16)
Für die weitere Rekonstruktion der historischen Ereignisse bis zur Kreuzigung, hat das Markusevangelium wahrscheinlich den höchsten Quellenwert, auch wenn es in den anderen Evangelien durchaus noch historisch wichtiges Material geben kann. Hinter diesem dürfte ein sehr alter Passionsbericht stehen. Dieser wurde für das Evangelium bearbeitet und mit weiteren Einzeltraditionen ergänzt. Das Johannesevangelium zeigt einige wichtige Unterschiede zum Markusevangelium. Hier muss man mit der Verarbeitung einer eigenen, unabhängigen Tradition rechnen, die im Einzelnen historische Ereignisse genauer überliefert als die Vorlage des Passionsberichts im Markusevangelium.
In jedem Fall muss man davon ausgehen, dass es sich bei den Evangelien nicht um neutrale Berichte handelt. Sie sind immer auch erzählerisch gestaltete Texte, die basierend auf historischen Hintergründen theologische Deutungen des Leidens und Sterbens Jesu darstellen.
[Literatur u.a.: Angelika Strotmann, Der historische Jesus S.168ff.]