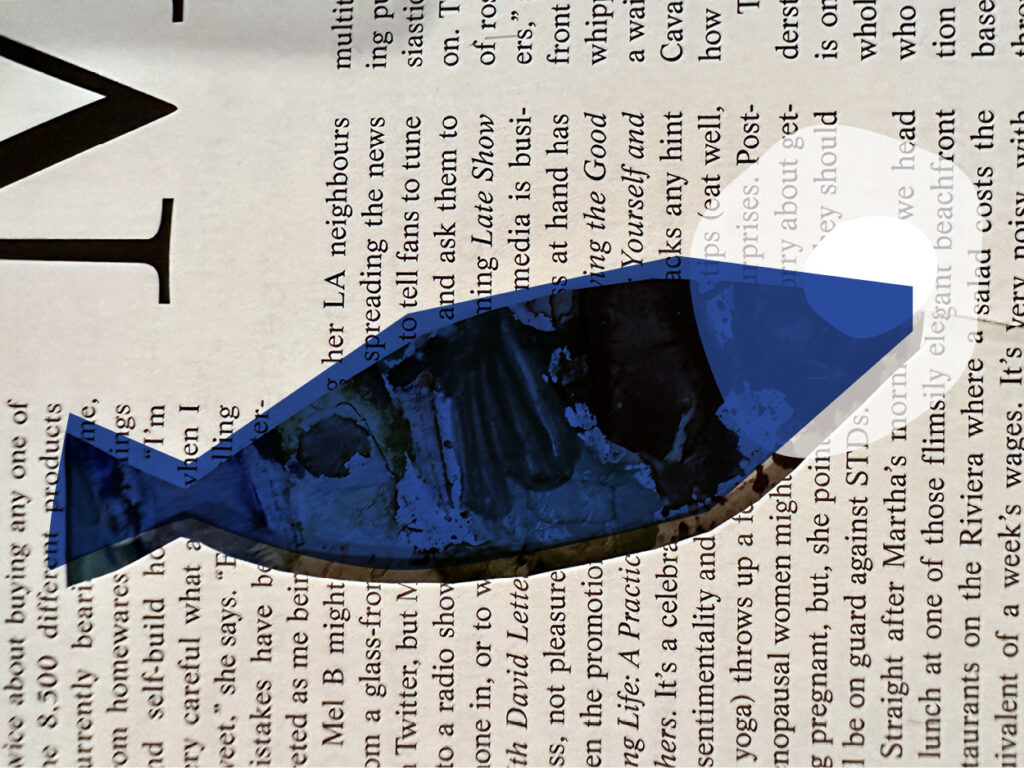Besonders der Bibelwissenschaftler Martin Ebner hat sich intensiv mit dem Aspekt der Weisheit im Leben Jesu beschäftigt. Er sieht Jesus von Nazaret durchaus als Weisheitslehrer an, betont aber, dass er kein Weisheitslehrer im klassischen jüdischen Verständnis gewesen ist wie ein Mann wie Jesus Sirach oder die Autoren einiger Weisheitsbücher. Er sieht in eher auf der „Linie der vielen weisen Frauen und Männer Israels“ die „Alltagserfahrungen für bestimmte Problem-„ oder „Streitsituationen auf den Punkt“ gebracht haben. Er kleidet diese Erfahrungen dann gern in eine Geschichte, „um einen Denkprozess anzustoßen, der das eigene (vorgefasste) Urteil hinterfragen“ und im Idealfall zu einer Veränderung des Denkens führen soll. Dieser Ansatz ist gerade bei den wichtigen Themen wie das in der Antike sehr wichtigem gemeinsamen Essen (Wer darf mit wem essen?) und der Frage nach den Quellen, aus denen sich sein Tun und seine Autorität speist, von besonderer Bedeutung (Welche Macht wirkt in ihm eigentlich?). Spannend zu beobachten dabei: Der Nazarener verteidigt sich nicht, in dem er sich auf eine besondere göttliche Offenbarung oder eine Anweisung „von oben“ beruft. Nein: Seine Argumente sind vernünftig und können vom Alltag abgelesen werden.
Wenn man auf die Mahlpraxis schaut, sieht das dann so aus: Weil Jesus auch mit gesellschaftlichen Randgruppen wie Zöllnern und Prostituierten zusammen isst und trinkt, wird er als „Fresser und Weinsäufer“ (LkQ 7,34) beschimpft. Der Vorwurf: Du setzt dich mit den falschen Leuten an einen Tisch, die von seinen Gegnern als „Sünder“ gesehen werden und mit denen sie selbst nichts zu tun haben wollen!. Im Markusevangelium pariert Jesus diesen Vorwurf mit einem Weisheitsspruch: „Nicht die Gesunden bedürfen des Arztes, sondern die Kranken.“ (Mk 2,17). Das ist eine bekannte Alltagserfahrung: Es geht um die Bedürftigkeit der Menschen, um seine Heilung und um Hilfe. Die Gegner sollen nach seiner Ansicht die von ihnen abgestempelten und in Negativ-Schubladen gesteckten Menschen anders wahrnehmen. Der Spruch lädt ein, sie als Verworfene zu sehen, sondern als Hilfsbedürftige. Sie brauchen einen Arzt wie Jesus und darum ist er in ihrer Nähe und hat Gemeinschaft mit ihnen und hilft und heilt. Die Gegenseite musste sich dann überlegen oder entscheiden, ob sie diesen Denkweg mitgeht.
Noch heftiger wird der Nazarener angegangen im Blick auf die Frage, mit welchen Kräften er denn Menschen heilt und Dämonen austreibt. Das war in der damaligen Zeit und Denke DIE entscheidende Frage und gleichzeitig ein nicht ungefährlicher Vorwurf: Du treibst nicht mit der Kraft Gottes, sondern mit Hilfe einer dunklen und fremden Macht – dem Beelzebul – die Dämonen aus. Er wäre dann sozusagen ein „V-Mann der Gegenseite“. Um auf diesen Vorwurf zu kontern, greift Jesus gleich auf mehrere Weisheitsspräche zurück. Zunächst weist er auf die zerstörerische Macht der Spaltung in einem Reich selbst des Bösen hin: Jedes Reich, das in sich selbst gespalten ist, wird veröden und ein Haus ums andere stürzt ein. Wenn also der Satan in sich selbst gespalten ist, wie kann sein Reich dann Bestand haben? Ihr sagt doch, dass ich die Dämonen mit Hilfe von Beelzebul austreibe. (Lk 11,17f) Vermutlich kannten viele seiner Mitmenschen aus eigener Erfahrung die zerstörerische Wirkung der inneren Spaltung z.B. auch in Palästina oder in den Nachbarstaaten oder auch in ihrem eigenen Haushalt.
Schließlich verweist er noch auf die Erfahrungen von Plünderungen: Niemand lässt doch zu, dass sein Haus ausgeraubt wird, es sei denn, man hätte ihn vorher gefesselt: Es kann aber auch keiner in das Haus des Starken eindringen und ihm den Hausrat rauben, wenn er nicht zuerst den Starken fesselt; erst dann kann er sein Haus plündern. (Mk 3,27) Jesus hat für sich klar, dass der entscheidende Kampf gegen eine Gegenmacht wie den Satan oder Teufel schon stattgefunden hat. Dem Bösen sind somit die Möglichkeiten genommen, das Menschenhaus zu schädigen und „auszuplündern“.
Auch wenn das für uns Heutige nicht mehr unbedingt nachvollziehbar ist: Die Vorwürfe im Blick auf Jesu Macht und dessen Herkunft waren so heftig, dass er sich mit allen Mitteln der Weisheit und der in ihr liegenden Vernunft dagegen wehren musste! Sonst hätte er wohl kaum noch als Heiler und von Dämonen befreiender „Arzt“ wirken können. Es ging an dieser Stelle für ihn buchstäblich um Alles oder Nichts – um die mögliche weitere Ausbreitung des Gottesreichs oder dessen Ende, weil er als Diener böser Mächte gebrandmarkt und ausgestoßen worden wäre.
Neben diesen kämpferisch anmutenden Einsätzen von Weisheitsworten in durchaus heftigen Streitsituationen setzte Jesus aber vor allem im Rahmen seiner Verkündigung und Lehre weisheitliche Lebenseinsichten ein. Sie sind nicht selten bis heute geradezu „sprichwörtlich“ geworden und immer noch selbsterklärend:
Niemand kann zwei Herren dienen. (Mt 6,24)
Können denn die Hochzeitsgäste fasten, solange der Bräutigam bei ihnen ist? (Mk 2,19)
Erntet man etwa von Dornen Trauben oder von Disteln Feigen? (Mt 7,16)
Daneben gibt es aber auch eine ganze Reihe von kurzen Geschichten wie die vom verlorenen Schaf (LkQ 15,4-7) oder von den Talenten (Mt 25,14-30), in denen sich Alltagserfahrungen (weisheitlich) verdichten und die in unserer Kultur zu geflügelten Worten geworden sind.
Fest steht: Von der Quellenlage her gehören die Weisheitsworte, wie sie in einer frühen Textsammlung (der Spruchquelle Q) zu finden sind, und viele Pointen der Ausspräche Jesu aus dem Markusevangelium zum „Urgestein der Jesusüberlieferung“, wie Martin Ebner es ausdrückt.
Entsprechend kommen die Motive, die in weisheitlichen Worten und Geschichten zu finden sind, aus der Welt seiner „Zielgruppe“, der Welt des kleinen Mannes: Es geht um die Agrar- und Hauswirtschaft (z.B. Mk 4,3ff; LkQ 15,3-7), um Kommunikations- und Verhaltensweisen (z.B. LkQ 6,37-42); Mk 9,40), manchmal auch um religiöse Bereiche wie den Sabbat (z.B. Mt 12,11) oder die Frage der Reinheit (z.B. Mk 7,15).
Als besonders herausfordernd erleben viele Menschen heute die Aufforderung, von den Raben und Lilien zu lernen, die Jesus ach Ansicht Martin Ebners vor allem an den Kreis der Menschen richtet, die ihm als Gruppe nachfolgen: Und er sagte zu seinen Jüngern: Deswegen sage ich euch: Sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt! Denn das Leben ist mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung. Seht auf die Raben: Sie säen nicht und ernten nicht, sie haben keine Vorratskammer und keine Scheune; und Gott ernährt sie. Wie viel mehr seid ihr wert als die Vögel! Wer von euch kann mit all seiner Sorge sein Leben auch nur um eine kleine Spanne verlängern? Wenn ihr nicht einmal etwas so Geringes könnt, warum macht ihr euch dann Sorgen um das Übrige? Seht euch die Lilien an, wie sie wachsen: Sie arbeiten nicht und spinnen nicht. Doch ich sage euch: Selbst Salomo war in all seiner Pracht nicht gekleidet wie eine von ihnen. Wenn aber Gott schon das Gras so kleidet, das heute auf dem Feld steht und morgen in den Ofen geworfen wird, wie viel mehr dann euch, ihr Kleingläubigen! Und darum auch ihr: Sucht nicht, was ihr essen und was ihr trinken sollt, und ängstigt euch nicht! 30 Denn nach all dem streben die Heiden in der Welt. Euer Vater weiß, dass ihr das braucht. Vielmehr sucht sein Reich; dann wird euch das andere dazugegeben. (LkQ 12,22-31)
Dieses auf den ersten Blick idyllisch wirkende Bild changiert bewusst zwischen Tier- Pflanzen- und Menschenwelt. Besonders im Blick die Menschen, die das sesshafte Leben in ihren Dörfern aufgegeben haben und mit ihm durch das Land ziehen, wird hier verdeutlicht: Du kannst selbst beobachten, dass Gott bestens für seine Geschöpfe sorgt. Sie sollen lernen, dass „sie als Menschen Gott doch viel mehr wert sind als Tiere oder Pflanzen“ (Ebner Handbuch S.421). Daraus kann sich eine restlos auf Gott bauende Sorglosigkeit entwickeln, die aber keine Naivität meint.
In einem anderen Doppelspruch will Jesus ebenfalls das Vertrauen zu Gott stärken, indem er auf den Mutter- oder Vaterinstinkt der Menschen setzt: Oder welcher Vater unter euch, den der Sohn um einen Fisch bittet, gibt ihm statt eines Fisches eine Schlange oder einen Skorpion, wenn er um ein Ei bittet? (LkQ 11,11f)
Eine große Wirkungsgeschichte haben nicht zuletzt auch Beispielgeschichten, allen voran die Erzählung vom barmherzigen Samariter. Diese Geschichten sollen zur Nachahmung anregen und ermuntern. Ausgerechnet der den Juden wenig sympathische Samaritaner tut das, was man von dem jüdischen Priester und dem Leviten, die beide mitleidlos an dem schwerkranken Überfallenen vorbeilaufen, erwarten würde.
Diese und andere Beispielgeschichten „haben die konkrete gesellschaftspolitische Situation in Palästina zur Zeit Jesu vor Augen. Sie erzählen von Menschen, die `anders´ sind und sich `anders´ verhalten – und damit mitten in der `alten Welt´ etwas Neues zum Vorschein kommen lassen, das sich daran orientiert, wie Gott sich Israel vorstellt: frei von Fremdherrschaft, frei von gegenseitiger Ausbeutung, fürsorglich für die am Rande, brüderlich unter den zwölf Stämmen (zu denen auch die Samaritaner gehören).“ (Ebner Handbuch S.422)
Immer aber geht es darum, dass Jesus die Menschen in ihrem Denken und auf der Erfahrungsebene ernst nimmt und sie mitnehmen kann auf den Weg einer eigenen Urteilfindung auf der Ebene von Weisheit und Vernunft. Alles, was der Mensch dazu braucht, ist die Bereitschaft sich auf diesen Weg einzulassen und zu entschlüsseln, was zunächst noch nicht klar und deutlich ist. Wer Ohren hat zum Hören, der höre! (Lk 8,8)
[Literatur u.a.: Martin Ebner, in Jesus-Handbuch S.417 ff.]