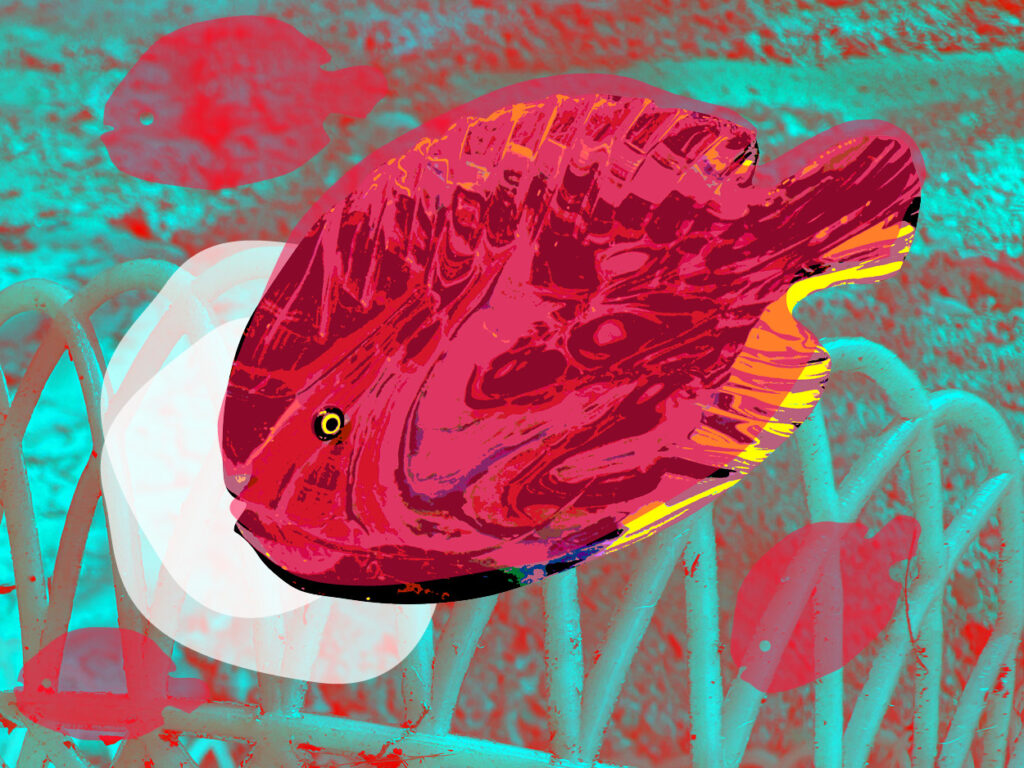Das muss man sich an dieser Stelle einmal bewusst machen! Der Begründer der im Jahr 2021 mit einer Zahl von zirka 2,3 Milliarden Anhänger:innen weltweit größten und weiterhin wachsenden Religion des Christentums hat wahrscheinlich nur ein bis maximal drei Jahre in einer kleinen römischen Provinz am Rande des römischen Reiches seine Botschaft verkündet und in deren Sinn gewirkt! Und: Er wurde öffentlich verurteilt und schändlich in Jerusalem durch den Tod des Kreuzes hingerichtet. Das allein ist eigentlich schon eine unglaubliche Geschichte …
Gleichzeitig stellt sich damit die Frage nach der Anziehungskraft des Jesus von Nazaret in besonderem Maße: Was hat ihn für die Menschen seiner Zeit und in der Gegend des jüdischen Galiläas so attraktiv gemacht? Und warum ging dieser Weg überhaupt weiter? Was macht bis heute die Faszination des Jesus aus dem kleinen Ort Nazaret aus? So stellt die Bibelexpertin Angelika Strotmann logischerweise die Frage, was denn „eigentlich dieses Königreich inhaltlich auszeichnet und so attraktiv macht, dass Menschen ihr Leben verändern, um hineinzukommen.“ (AS 114)
Zwei weitere Wissenschaftler – Annette Merz und Gerd Theißen – (S.175) haben den Begriff des Charismas eingebracht, um die Autorität Jesu näher zu beschreiben. Sie wählten dabei bewusst einen religionswissenschaftlichen Begriff aus, der unabhängig von sonstigen Titeln ist, die Jesus zugeschrieben wurden, und dennoch biblischen Aussagen entspricht: In begegnet der Begriff exousia, der mit Vollmacht übersetzt werden kann: Sie kamen nach Kafarnaum. Am folgenden Sabbat ging er in die Synagoge und lehrte. Und die Menschen waren voll Staunen über seine Lehre; denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat, nicht wie die Schriftgelehrten. (Mk 1,21ff)
Charisma beschreiben Merz und Theißen als eine starke „Ausstrahlungskraft auf andere Personen.“ Es entfaltet sich immer in Interaktionen und zeigt sich bei Jesus im Blick auf seinen Lehrer Johannes den Täufer, auf seine Nachfolger:innen, auf die Menschen um ihn herum und auf seine Gegner. Vielleicht ist der Begriff „charismatische Persönlichkeit“ für Jesus am passendsten, da die Rede vom „Charismatiker“ aufgrund bestimmter pfingstlerisch-freikirchlicher Konnotationen mittlerweile eine gewisse Engführung erfahren hat. Allerdings ist an dieser Stelle auch darauf hinzuweisen, dass eine charismatische Persönlichkeit aus soziologischer Perspektive auch zum Beispile bei Führern faschistoider oder diktatorischer Systeme angewandt werden könnte. Es stellt sich somit die Aufgabe, immer wieder menschenfreundlich eingesetztes Charisma von manipulativen und letztlich menschenverachtenden Formen zu unterscheiden. Schon im Urchristentum hat man den Messias von einem Pseudomessias, den Propheten von einem Pseudopropheten zu unterscheiden gewusst. (Theißen/ Merz 217).
Über die Person Jesu und seine charismatische Persönlichkeit erfahren wir vor allem über seine zwischenmenschlichen Begegnungen (Theißen/Merz 216).
Seine Familie irritierte er so sehr, dass sie ihn für „verrückt“ hielt (Mk 3,21). Sie will ihn aus der Gruppe seiner Anhänger:innen mit Gewalt herausholen. Hier zeigt sich, dass sein Charisma Jesus die Fähigkeit verleiht, unkonventionelle Werte und Verhaltensweisen zu vertreten. Er nahm sogar Frauen in seinen Jünger:innenkreis auf und wählte für sie frauenspezifische Bilder und Aussagen neben denen zu den Männern aus.
Sein heilendes und exorzistisches Charisma, das er im Anschluss an die Täuferzeit entdeckte, setzte er als „Lichtzeichen“ des anbrechenden Gottesreichs hilfreich und befreiend und nicht selten „rettend“ ein und gab es an seine Jünger:innen weiter. Das Charisma diente somit nicht der Selbstinszenierung des Wundertäters, sondern dem Heil der Menschen und damit der Verbreitung seiner Botschaft. Überhaupt beruft er seine Jünger:innen auf der Basis seiner charismatischen Autorität in seine Nachfolge. (Theißen/ Merz 198)
Besonders spannend ist das Wirken seiner charismatischen Persönlichkeit im Blick auf seine Gegner. Es versetzte ihn in die Lage, Angriffe und Abwertungen aus seiner Umwelt positiv umzuinterpretieren. Obwohl die Schriftgelehrten in der Tendenz nicht auf seiner Seite stehen, kann er sich zum Beispiel mit einem von ihnen im zentralen Punkt der Gottes- und Nächstenliebe einigen.
Ein Schriftgelehrter hatte ihrem Streit zugehört; und da er bemerkt hatte, wie treffend Jesus ihnen antwortete, ging er zu ihm hin und fragte ihn: Welches Gebot ist das erste von allen? Jesus antwortete: Das erste ist: Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Als zweites kommt hinzu: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist größer als diese beiden. Da sagte der Schriftgelehrte zu ihm: Sehr gut, Meister! Ganz richtig hast du gesagt: Er allein ist der Herr und es gibt keinen anderen außer ihm und ihn mit ganzem Herzen, ganzem Verstand und ganzer Kraft zu lieben und den Nächsten zu lieben wie sich selbst, ist weit mehr als alle Brandopfer und anderen Opfer. Jesus sah, dass er mit Verständnis geantwortet hatte, und sagte zu ihm: Du bist nicht fern vom Reich Gottes. (Mk 12,28ff)
Jesus zeichnet sich als charismatische Persönlichkeit auch durch seine kommunikativen, ja dichterischen Fähigkeiten aus. Hier ist auf das Erzählen von Gleichnissen zu verweisen, die im Allgemeinen als authentische Jesusüberlieferung gelten. Sicher ist Jesus hier geprägt von jüdischen Vorlagen und Metaphern, bringt hier aber eine unverkennbare, individuelle Prägung ein (T-M 303). Er ist in der Lage, den traditionellen Bilder- und Motivschatz neu auf seine Hörer:innen hin zu aktualisieren. Immer wieder bezieht er seine Zuhörer:innen und deren Alltagswelt mit ein und erschafft pointierte und aufrüttelnde Narrative.
Wenn eine Frau zehn Drachmen hat und eine davon verliert, zündet sie dann nicht eine Lampe an, fegt das Haus und sucht sorgfältig, bis sie die Drachme findet? Und wenn sie diese gefunden hat, ruft sie die Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und sagt: Freut euch mit mir, denn ich habe die Drachme wiedergefunden, die ich verloren hatte! (Lk 15,8f)
Am Ende der sogenannten Bergpredigt das sehr anschauliche Bild vom Hausbau:
Jeder, der diese meine Worte hört und danach handelt, ist wie ein kluger Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als ein Wolkenbruch kam und die Wassermassen heranfluteten, als die Stürme tobten und an dem Haus rüttelten, da stürzte es nicht ein; denn es war auf Fels gebaut. Und jeder, der diese meine Worte hört und nicht danach handelt, ist ein Tor, der sein Haus auf Sand baute. Als ein Wolkenbruch kam und die Wassermassen heranfluteten, als die Stürme tobten und an dem Haus rüttelten, da stürzte es ein und wurde völlig zerstört. (Mt 7,24-27)
Mit den Gleichnissen hat er eine populäre Form gewählt, die allen Menschen zugänglich war. Durch die Konfrontation mit Gottes Absichten, seinem „Willen“, vermittelt er gleichzeitig seinen Hörer:innen „ein hohes Selbstverständnis: ein aristokratisches Ethos der Verantwortung und Risikobereitschaft.“ (Theißen/Merz 308) Gleichzeitig zeigt er darin eine undogmatische Art, von Gott zu sprechen. Seine metaphorische Sprache will nicht zum Ausdruck bringen, wie man schon immer über Gott dachte oder vorschreiben, was man über ihn denken soll. Sie will Impulse geben, immer wieder neu und anders von ihm zu denken. Es geht somit immer auch um die Eigenständigkeit des Menschen und damit auch um sein eigenes Denken und die eigene Verantwortung.
Seine besondere Ausstrahlungskraft zeigt sich auch darin, dass er über den Kreis seiner Anhänger:innen hinaus Sympathisanten ansprechen und gewinnen kann, durchaus auch größere Volksmengen (T-M 201). Und das offensichtlich bis heute …
[Literatur u.a.: Angelika Strotmann, Der historische Jesus S,114f.; Gerd Theißen/Annette Merz, Der historische Jesus 216f.]