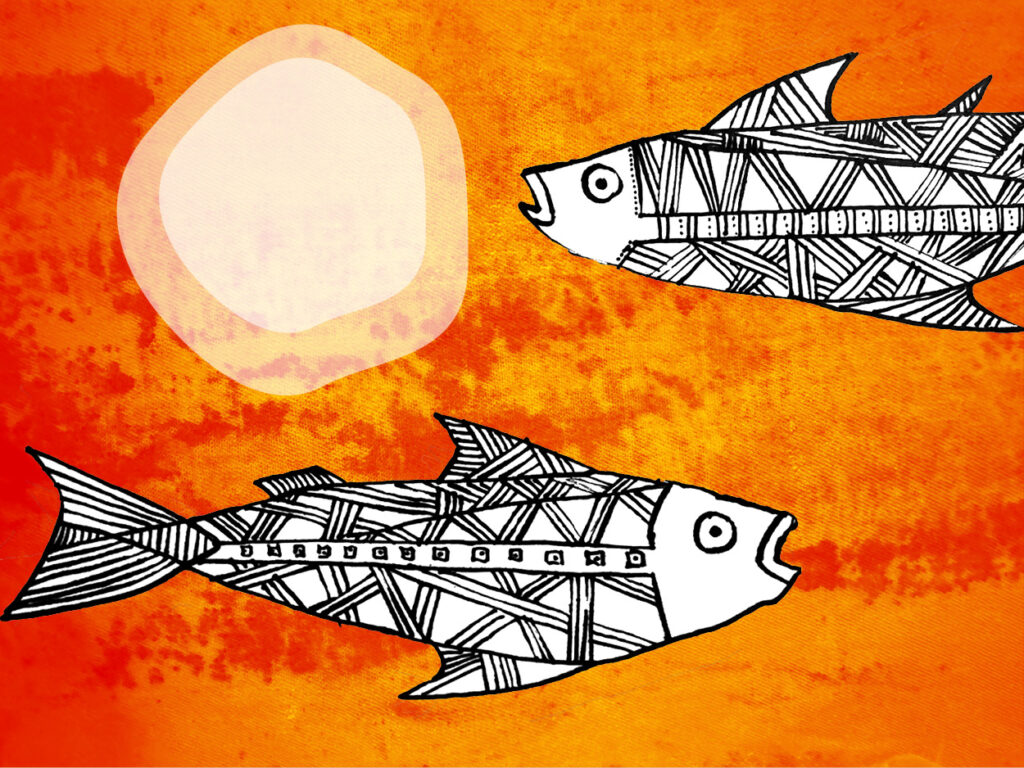Von kaum einer Person der Antike wissen wir soviel über deren Gebetsleben wie das bei Jesus von Nazaret der Fall ist. Auch der zeitliche Abstand zu den ersten Aufschrieben darüber ist relativ kurz. Wahrscheinlich haben noch einige Menschen, die Jesus persönlich erlebt oder von anderen über ihn gehört hatten, vieles davon aufbewahrt und mündlich weitergegeben oder aufgeschrieben.
Für einen religiösen Menschen wie Jesus war das Beten eine selbstverständliche Praxis. Der Mann aus Nazaret hat dabei sowohl „frei“ gebetet, also Gott in seinen eigenen Worten und auf seine Art sehr persönlich das gesagt, was ihm auf dem Herzen lag. Diese Art zu beten hat er dabei nicht „erfunden“, auch andere Menschen seiner Umgebung haben so gebetet. Jesus hat aber auch die festen Gebetsgewohnheiten seiner jüdischen Religionsgruppe praktiziert, zum Beispiel hielt er sich oft in Synagogen und auch im Tempel auf. Immer wieder hat er sich zum Sprechen mit Gott und zum Hören auf ihn in die Abgeschiedenheit zurückgezogen. Es gibt somit nicht die eine Gebetsweise Jesu, sondern eine ziemlich „bunte“ Mischung an Gebetsformen, die immer sozusagen aus der jeweiligen Lebenssituation heraus entstanden sind, in der er und seine Mitmenschen sich gerade befanden.
Jesus betete für andere Menschen, zum Beispiel für Simon Petrus, einen seiner Schüler: Simon, Simon, siehe, der Satan hat verlangt, dass er euch wie Weizen sieben darf. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht erlischt. (Lk 22,31f) Er dankte Gott aber auch oder sprach ein Segensgebet zum Beispiel für Kinder: Und er nahm die Kinder in seine Arme; dann legte er ihnen die Hände auf und segnete sie. (Mk 10,16) Sehr persönliche Gebete sind aber auch aus Momenten überliefert, in denen er gelitten hat, so im Garten Getsemani in der Nähe von Jerusalem kurz vor seinem Tod: Abba, Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir! Aber nicht, was ich will, sondern was du willst. (Mk 14,36) Er bittet hier nicht nur um die Vermeidung des Leidens, das er auf sich zukommen sieht, sondern fügt sich gleichzeitig in den Willen Gottes. Auch für die Zeit gegen 15 Uhr am Tag seiner Kreuzigung heißt es, dass er mit lauter Stimme ein Gebet förmlich herausschrie: Eloï, Eloï, lema sabachtani?, das heißt übersetzt: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? (Mk 15,34)
Jesus hat nach dem Befund der Bibelwissenschaft sein Leben als ein Leben vor und mit Gott geführt. Der Bibelexperte Karl-Heinrich Ostmeyer hat Jesus daher als einen „seinem Wesen nach Betenden“ Menschen charakterisiert. Das Beten und Umgehen mit Gott gehört sozusagen zu seiner DNA, seine Zwiesprache mit Gott war einzigartig und intensiv. Und es war davon geprägt, dass er sich selbst als grundlegenden Teil des von Gott her herbeigeführten Gottesreiches verstand, von dessen Ankommen schon in den jüdischen heiligen Schriften die Rede war.
Als Jude hat Jesus dann sicher auch in der Synagoge gebetet sowie bei den Festen und religiösen Ritualen wie Beschneidungen, dem Pessach, usw. Er betete vor den Mahlzeiten und natürlich auch bei seinem letzten Abendmahl mit seinen Jüngern. Der bereits erwähnte Bibelfachmann Karl-Heinrich Ostmeyer vermutet, dass Jesus auch die üblichen Gebetszeiten seines jüdischen Umfelds übernommen hat, also mindestens dreimal am Tag betete. Ob er in dieser Zeit schon das jüdische Glaubensbekenntnis, das Schema-Gebet, morgens und abends betete, kann man nicht mit Sicherheit sagen. Seine Gebete wird er in der Regel im Stehen verrichtet haben, im Moment des verzweifelten Betens im Garten Getsemani wirft er sich aber in seiner ganzen Not und Verzweiflung vor Gott auf den Boden.
Jesus betet für sein Jünger und weist sie an, was und wie sie beten sollen. Sie sollen nicht gedankenlos plappern und sich auf das Wesentliche konzentrieren. Sie sollen sich zum Gebet in einen intimen oder geschützten Bereich zurückziehen, außerhalb der Öffentlichkeit, so wie Jesus es selbst auch praktiziert hat: Wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler! Sie stellen sich beim Gebet gern in die Synagogen und an die Straßenecken, damit sie von den Leuten gesehen werden. Amen, ich sage euch: Sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Du aber, wenn du betest, geh in deine Kammer, schließ die Tür zu; dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist! Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, die meinen, sie werden nur erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie; denn euer Vater weiß, was ihr braucht, noch ehe ihr ihn bittet. (Mt 6,5-8)
Entscheidend am Beten ist die gelebte Vater-Kind-Beziehung zwischen dem Betenden und Gott, wobei auch hier darauf hingewiesen werden soll, dass es gerade in diesem intimen Verhältnis stark auch um die mütterlich-fürsorgliche Seite Gottes geht, die Metapher „Vater“ also keinesfalls einseitig „männlich“ ausgelegt werden darf!
Die Anweisungen Jesu zu den Inhalten der Gebete beziehen sich vor allem auf das anbrechende Gottesreich. Jesus fordert seine Anhänger:innen unter anderem dazu auf, für mehr Arbeiter:innen für die „Ernte“ zu bitten, dass es somit fruchtbar unter den Menschen wirken kann: Jesus zog durch alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen, verkündete das Evangelium vom Reich und heilte alle Krankheiten und Leiden. Als er die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen; denn sie waren müde und erschöpft wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sagte er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden! (Mt 9,35-38par)
Grundlegend wichtig dazu scheint dann auch dieser weitere Aspekt zu sein: Da das Kindschaftsverhältnis zwischen Gott und Mensch fest und zuverlässig ist, soll entsprechend auch die Kommunikation zwischen dem Beter und dem Angebeteten nicht abbrechen. Wenn Jesus zu einem dauerhaften Gebet auffordert, dann will er damit nicht zu einem „Leistungsbeten“ aufrufen, sondern eher diese sozusagen natürliche Verbindung zwischen Betendem und Gott zum Klingen bringen: Jesus sagte ihnen durch ein Gleichnis, dass sie allezeit beten und darin nicht nachlassen sollten: In einer Stadt lebte ein Richter, der Gott nicht fürchtete und auf keinen Menschen Rücksicht nahm. In der gleichen Stadt lebte auch eine Witwe, die immer wieder zu ihm kam und sagte: Verschaff mir Recht gegen meinen Widersacher! Und er wollte lange Zeit nicht. Dann aber sagte er sich: Ich fürchte zwar Gott nicht und nehme auch auf keinen Menschen Rücksicht; weil mich diese Witwe aber nicht in Ruhe lässt, will ich ihr Recht verschaffen. Sonst kommt sie am Ende noch und schlägt mich ins Gesicht. Der Herr aber sprach: Hört, was der ungerechte Richter sagt! Sollte Gott seinen Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm schreien, nicht zu ihrem Recht verhelfen, sondern bei ihnen zögern? (Lk 18,1-7)
In diesem Gleichnis klingt neben der Hartnäckigkeit und Ausdauer des Betens auch der Aspekt der allerdings erzwungenen „Fürsorge“ an. Mehr als dieser sture Richter weiß Gott um die Bedürfnisse seiner Kinder, schon bevor diese sie ausgesprochen haben: (…) euer Vater weiß, was ihr braucht, noch ehe ihr ihn bittet (Mt 6,31), wie es an anderer Stelle heißt.
Mit all diesem Grundwissen im Gepäck ist es dann gut möglich, das sogenannte „Vaterunser“ einzuordnen und zu verstehen, das nach der griechischen Urform eigentlich besser „Unser Vater“ heißen müsste. Jesus hat sicher eine Form des Gebets in aramäischer Sprache an seine Jünger:innen weitergegeben. Dies wurde dann in die griechische Sprache übertragen, mit der mehr Menschen angesprochen werden konnten. Die meisten Bibelwissenschaftler nehmen an, dass folgende vier Bitten des Gebets zu dieser griechischen Urform gehörten:
Unser Vater, geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe.
Gib uns täglich das Brot, das wir brauchen!
Wie Jesus sollen auch seine Nachfolger:innen Gott mit „Abba“ – „mein Vater“ oder „lieber Vater“ -ansprechen. Sie treten damit wie er in das Kindschaftsverhältnis zu Gott ein, das unabhängig vom Alter der Beter funktioniert und das Jesus gelehrt und damit vermittelt hat. Das „Unser Vater“ (das heute berechtigterweise auch als „Unsere Mutter“ gebetet wird) bietet die Botschaft Jesu und sein Wirken in Kompaktform. Das vom Nazarener verkündigte Gottesreich möge bald kommen. Die Fürsorge Gottes soll in der täglich erhaltenen Versorgung erfahrbar werden. Der gute Wille Gottes für die Menschen soll im Wachsen einer heilsamen und gerechten Gesellschaftsordnung seine Ausformung und seine Gestalt gewinnen.
[Literatur u.a.: Karl-Heinrich Ostmeyer, in Jesus Handbuch S.395ff.]